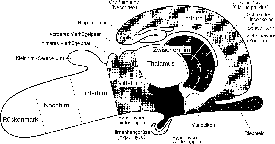
Abbildung 5: Die inneren Strukturen eines menschlichen Gehirns. (Quelle: nach NAUTA/FEIRTAG :94)
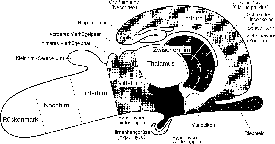
Abbildung 5: Die inneren Strukturen eines menschlichen Gehirns.
(Quelle: nach NAUTA/FEIRTAG :94)
Die entscheidenden Bereiche des Wirbeltiergehirns sind in der Evolution
gleichzeitig entstanden. ROTH (:184)
betont in seinen Ausführungen, daß es keine stammesgeschichtlich
ursprünglichen oder stammesgeschichtlich neuen Hirnregionen gibt.
Die verschiedenen Hirnteile und die Großhirnrinde haben allerdings
in den unterschiedlichen Wirbeltiergruppen ein sehr unterschiedliches
anatomisches Schicksal erfahren, sind etwa groß oder klein geworden,
komplex oder vereinfacht (ROTH :184).
Auch zeigen neuroanatomische und physiologische Untersuchungen, daß
die einzelnen Hirnteile aufs engste miteinander verbunden sind. Sowohl das Rückenmark als auch die zur Hirnbasis zählenden Strukturen
des Mittel-, Hinter- und des Nachhirns mit seinem verlängerten Rückenmark
steuern die vegetativen (von lt. vegetatus - munter, belebt) Funktionen
des Körpers wie beispielsweise Atmung, Blutdruck und Verdauung. Das
Kleinhirn und die Basalganglien, welche das Hinterhirn kennzeichnen, koordinieren
und regulieren gemeinsam sämtliche Bewegungen des menschlichen Körpers.
Im Hirninnern befindet sich das Zwischenhirn mit seinem limbischen System.
Letzteres besteht aus einer Ansammlung von Strukturen wie beispielsweise
aus Hippocampus, Mandelkern (Amygdala) und Hypothalamus, die in emotionales
Verhalten involviert sind und für die langfristige Speicherung von
Informationen verantwortlich sind. Der obere Teil des Zwischenhirns heißt
Thalamus und ist in eine linke und rechte Hälfte geteilt. Der untere
Teil wird als Hypothalamus bezeichnet. Dieser beinhaltet unter anderem
das Kontrollzentrum für Nahrungsaufnahme. Alle Informationen, die
ins Großhirn gelangen, unterliegen vorher der Kontrolle des Zwischenhirns.
Jede Information passiert beispielsweise den Thalamus auf dem Weg zum großen
``Analysator'', der vereinfacht ausgedrückt für die geistigen
Fähigkeiten des Menschen verantwortlich ist. Als eine wichtige Schaltstation
leitet der Thalamus mit Ausnahme des Geruchs alle Sinnesimpulse, die über
aufsteigende (afferente) Fasern (Nerven) transportiert werden, zur Großhirnrinde.
Sowohl das Rückenmark als auch die zur Hirnbasis zählenden Strukturen
des Mittel-, Hinter- und des Nachhirns mit seinem verlängerten Rückenmark
steuern die vegetativen (von lt. vegetatus - munter, belebt) Funktionen
des Körpers wie beispielsweise Atmung, Blutdruck und Verdauung. Das
Kleinhirn und die Basalganglien, welche das Hinterhirn kennzeichnen, koordinieren
und regulieren gemeinsam sämtliche Bewegungen des menschlichen Körpers.
Im Hirninnern befindet sich das Zwischenhirn mit seinem limbischen System.
Letzteres besteht aus einer Ansammlung von Strukturen wie beispielsweise
aus Hippocampus, Mandelkern (Amygdala) und Hypothalamus, die in emotionales
Verhalten involviert sind und für die langfristige Speicherung von
Informationen verantwortlich sind. Der obere Teil des Zwischenhirns heißt
Thalamus und ist in eine linke und rechte Hälfte geteilt. Der untere
Teil wird als Hypothalamus bezeichnet. Dieser beinhaltet unter anderem
das Kontrollzentrum für Nahrungsaufnahme. Alle Informationen, die
ins Großhirn gelangen, unterliegen vorher der Kontrolle des Zwischenhirns.
Jede Information passiert beispielsweise den Thalamus auf dem Weg zum großen
``Analysator'', der vereinfacht ausgedrückt für die geistigen
Fähigkeiten des Menschen verantwortlich ist. Als eine wichtige Schaltstation
leitet der Thalamus mit Ausnahme des Geruchs alle Sinnesimpulse, die über
aufsteigende (afferente) Fasern (Nerven) transportiert werden, zur Großhirnrinde.
Die kognitiven Leistungen des Menschen sind in erster Linie mit dem
Großhirn, insbesondere mit der Großhirnrinde (Kortex) in Beziehung zu setzen. Die stark gefurchte Oberfläche des Kortex
ist nur etwa zwei Millimeter dick und in mehrere Windungen und Furchen
gefaltet. Weiterhin ist die Großhirnrinde deutlich in zwei Gehirnhälften
gegliedert, die linke und die rechte Hemisphäre. SCHWARZ (:62)
faßt die Großhirnrinde mit ihren beiden Hirnhälften als
eine Art Doppelorgan auf und setzt damit stillschweigend voraus,
daß die beiden Gehirnhälften Spiegelbilder voneinander sind.
Die meisten Forscher sind sich mittlerweile aber darüber einig, daß
die linke Hemisphäre größere kortikale Abschnitte der
Sprachfelder aufweist als die symmetrischen Zonen auf der anderen
Hemisphäre und daher als sprachdominant betrachtet werden kann
(POPPER/ECCLES :359). Befunde
bei etwa 80% menschlicher Gehirne zeigen Asymmetrien mit speziellen Ausformungen
der Großhirnrinde in den Gebieten sowohl der vorderen als auch hinteren
Sprachzentren.
in Beziehung zu setzen. Die stark gefurchte Oberfläche des Kortex
ist nur etwa zwei Millimeter dick und in mehrere Windungen und Furchen
gefaltet. Weiterhin ist die Großhirnrinde deutlich in zwei Gehirnhälften
gegliedert, die linke und die rechte Hemisphäre. SCHWARZ (:62)
faßt die Großhirnrinde mit ihren beiden Hirnhälften als
eine Art Doppelorgan auf und setzt damit stillschweigend voraus,
daß die beiden Gehirnhälften Spiegelbilder voneinander sind.
Die meisten Forscher sind sich mittlerweile aber darüber einig, daß
die linke Hemisphäre größere kortikale Abschnitte der
Sprachfelder aufweist als die symmetrischen Zonen auf der anderen
Hemisphäre und daher als sprachdominant betrachtet werden kann
(POPPER/ECCLES :359). Befunde
bei etwa 80% menschlicher Gehirne zeigen Asymmetrien mit speziellen Ausformungen
der Großhirnrinde in den Gebieten sowohl der vorderen als auch hinteren
Sprachzentren. Forscher hoffen, letztlich die unterschiedlichen Spezialisierungen der
beiden Hirnhälften beim Menschen anhand der anatomischen Asymmetrien
erklären zu können. Doch einige von ihnen weisen darauf hin,
daß die Spezialisierung bestimmter mentaler Fähigkeiten ein
durch das ganze Leben fortschreitender Prozeß ist (vgl. LEISCHNER ).
Forscher hoffen, letztlich die unterschiedlichen Spezialisierungen der
beiden Hirnhälften beim Menschen anhand der anatomischen Asymmetrien
erklären zu können. Doch einige von ihnen weisen darauf hin,
daß die Spezialisierung bestimmter mentaler Fähigkeiten ein
durch das ganze Leben fortschreitender Prozeß ist (vgl. LEISCHNER ).
Die Vorstellung, daß menschliche Gehirn sei funktionell asymmetrisch
organisiert, geht auf Broca zurück. Seine Vorstellung beruhte auf
der Annahme, die linke Hemisphäre sei die intelligente, sprach- und
vernunftbegabte Seite des menschlichen Gehirns, während der rechten
sprachlosen zu mißtrauen sei. Die rechte Hemisphäre befinde
sich in einem dauerhaft animalischen Zustand und berge minderwertige Prozesse
in sich, die der Kontrolle des Bewußtseins nicht zugänglich
gemacht werden können (vgl. ENDER 1994). Der Wendepunkt zu einer Einbeziehung
beider Hemisphären in das Geschehen mentaler, vornehmlich aber sprachlicher
Abläufe vollzog sich Mitte der sechziger Jahre dieses Jahrhunderts
mit dem Aufkommen unterschiedlicher Untersuchungsmethoden, die eigens zur
Klärung der Verteilung cerebral höherstehender Funktionen auf
beide Hemisphären entwickelt worden sind. Mit diesen Methoden kann
man Einblick in die Überwertigkeit der Gehirnhälften erhalten. Da unter bestimmten Bedingungen die linke Hemisphäre nur
Informationen des rechten Auges wahrnimmt, und die rechte Hemisphäre
nur Informationen des linken Auges,
erhalten. Da unter bestimmten Bedingungen die linke Hemisphäre nur
Informationen des rechten Auges wahrnimmt, und die rechte Hemisphäre
nur Informationen des linken Auges, können mit der Methode der gesichtsfeldabhängigen Reizdarbietung,
mit dem sogenannten Visual-Half-Field-Test (VHF-Methode), die unterschiedlichen
Leistungen der Gehirnhälften überprüft werden. Diese tachistoskopische
Darbietung bewirkt nämlich, daß nur eine Hemisphäre von
einem visuellen Reiz erreicht wird. Dabei darf die maximale Darbietungsdauer
von 150 ms nicht überschritten werden, da sonst ein Informationsaustausch
beider Hemisphären vor allem über das Corpus callosum stattfindet.
Eine zweite Methode ist das dichotische Hören,
können mit der Methode der gesichtsfeldabhängigen Reizdarbietung,
mit dem sogenannten Visual-Half-Field-Test (VHF-Methode), die unterschiedlichen
Leistungen der Gehirnhälften überprüft werden. Diese tachistoskopische
Darbietung bewirkt nämlich, daß nur eine Hemisphäre von
einem visuellen Reiz erreicht wird. Dabei darf die maximale Darbietungsdauer
von 150 ms nicht überschritten werden, da sonst ein Informationsaustausch
beider Hemisphären vor allem über das Corpus callosum stattfindet.
Eine zweite Methode ist das dichotische Hören, welches analog zur VHF-Technik funktioniert, indem nun auf beide Ohren
auditorische Reize gegeben werden. Obwohl akustische Informationen von
beiden Hemisphären verarbeitet werden, konnte nachgewiesen werden,
daß die überkreuzende (kontralaterale) Verarbeitung von wesentlicher
funktioneller Bedeutung ist. Diese beiden Testverfahren haben den großen
Vorteil, daß Untersuchungen an gesunden Versuchspersonen möglich
sind.
welches analog zur VHF-Technik funktioniert, indem nun auf beide Ohren
auditorische Reize gegeben werden. Obwohl akustische Informationen von
beiden Hemisphären verarbeitet werden, konnte nachgewiesen werden,
daß die überkreuzende (kontralaterale) Verarbeitung von wesentlicher
funktioneller Bedeutung ist. Diese beiden Testverfahren haben den großen
Vorteil, daß Untersuchungen an gesunden Versuchspersonen möglich
sind.
Mit Hilfe der tachistoskopischen Darbietung kann gezeigt werden, daß
sprachliche visuelle Reize, die dem rechten Gesichtsfeld präsentiert
werden, wesentlich schneller und sicherer erkannt werden als solche, die
dem linken Gesichtsfeld dargeboten werden. Hier liegt ein ``right-visual-field-advantage''
(RVF) vor. Bei der Darbietung nicht-sprachlicher visueller Reize wird der
umgekehrte Effekt beobachtet. In diesem Fall werden die präsentierten
Reize von dem linken Gesichtsfeld besser verarbeitet als von dem rechten.
Hier kommt ein ``left-visual-field-advantage'' (LVF) zum Ausdruck. Bei
den Ergebnissen der meisten dichotischen Untersuchungen zeigt sich, daß
das rechte Ohr eine bessere Fähigkeit zum Erkennen sprachlichen Materials
aufweist als das linke. Analog zum RVF-Effekt kommt hier ein ``right-ear-advantage''
(REA) zur Geltung. Demgegenüber verarbeitet das linke Ohr alles nicht-sprachliche
Material wirksamer als das rechte und man spricht hier von einem ``left-ear-advantage''
(LEA). Diese beiden Methoden bestätigen und bekräftigen die Dominanz
oder Überwertigkeit der linken Hemisphäre für sprachliche
Stimuli. Die rechte Gehirnhälfte hingegen ist der linken bei der
Verarbeitung aller nicht-sprachlichen [...] Reize überlegen (HEESCHEN/REISCHIES :41).
Sie verfügt aber noch über weitere Kompetenzen, wie beispielsweise
über musikalische Fähigkeiten und über räumlich-visuelle
Orientierung. Diese strenge Dichotomie ist bei genauer Betrachtung aber
eine Vereinfachung (SCHWARZ :66)
und bei intensiver Auseinandersetzung mit diesen Studien ist zu erkennen,
daß die rechte Hemisphäre keineswegs sprachlich so inkompetent
ist wie zunächst stillschweigend angenommen (HEESCHEN/REISCHIES :43).
Diese beiden Methoden bestätigen und bekräftigen die Dominanz
oder Überwertigkeit der linken Hemisphäre für sprachliche
Stimuli. Die rechte Gehirnhälfte hingegen ist der linken bei der
Verarbeitung aller nicht-sprachlichen [...] Reize überlegen (HEESCHEN/REISCHIES :41).
Sie verfügt aber noch über weitere Kompetenzen, wie beispielsweise
über musikalische Fähigkeiten und über räumlich-visuelle
Orientierung. Diese strenge Dichotomie ist bei genauer Betrachtung aber
eine Vereinfachung (SCHWARZ :66)
und bei intensiver Auseinandersetzung mit diesen Studien ist zu erkennen,
daß die rechte Hemisphäre keineswegs sprachlich so inkompetent
ist wie zunächst stillschweigend angenommen (HEESCHEN/REISCHIES :43).
Zieht man die Erkenntnisse noch hinzu, die aus den sogenannten Split-Brain-Operationen gewonnen werden konnten und heute immer noch neue Befunde erlauben, so
ergibt sich bezüglich der rechtshemisphärisch mentalen Fähigkeiten
die Notwendigkeit, die Vorstellung der Zweiteilung nonverbal/verbal aufzugeben.
gewonnen werden konnten und heute immer noch neue Befunde erlauben, so
ergibt sich bezüglich der rechtshemisphärisch mentalen Fähigkeiten
die Notwendigkeit, die Vorstellung der Zweiteilung nonverbal/verbal aufzugeben.
ZAIBEL (1972) war der erste Forscher, der die rechtshemisphärische
Sprache bei Split-Brain-Patienten systematisch untersuchte. Dabei konnte er zeigen, daß die rechte
Hemisphäre über einen rezeptiven Wortschatz verfügt, dessen
Umfang etwa dem eines vierzehnjährigen Kindes entspricht. Gegenstände,
die in die rechte Gesichtsfeldhälfte projiziert wurden, konnten zwar
nicht benannt, aber aus einer Anzahl von Gegenständen mit der linken
Hand richtig ausgewählt werden. Die rechte Hemisphäre weiß
also, was sie sieht, kann diese Information nur nicht ohne weiteres verbalisieren
(vgl. SPRINGER/DEUTSCH (). Experimente
bei Split-Brain-Patienten belegen, daß die rechte Hemisphäre
eindeutig sowohl über rezeptive als auch über produktive Kompetenzen
systematisch untersuchte. Dabei konnte er zeigen, daß die rechte
Hemisphäre über einen rezeptiven Wortschatz verfügt, dessen
Umfang etwa dem eines vierzehnjährigen Kindes entspricht. Gegenstände,
die in die rechte Gesichtsfeldhälfte projiziert wurden, konnten zwar
nicht benannt, aber aus einer Anzahl von Gegenständen mit der linken
Hand richtig ausgewählt werden. Die rechte Hemisphäre weiß
also, was sie sieht, kann diese Information nur nicht ohne weiteres verbalisieren
(vgl. SPRINGER/DEUTSCH (). Experimente
bei Split-Brain-Patienten belegen, daß die rechte Hemisphäre
eindeutig sowohl über rezeptive als auch über produktive Kompetenzen auf dem sprachlichen Gebiet verfügt, allerdings überwiegt die
rezeptive Seite bei der Verarbeitung sprachlicher Stimuli (vgl. BRADSHAW/NETTLETON
1981). Die rechtshemisphärische Sprachproduktion besteht hauptsächlich
aus Klischees und konventionellen Redewendungen (z.B. Guten Tag)
und aus der Verwendung konkreter hochfrequenter (häufig vorkommender)
Wörter (vgl. LEUNINGER 1989). Abstrakte, hochfrequente Wörter
hingegen werden in erster Linie von der linken Hemisphäre verarbeitet.
auf dem sprachlichen Gebiet verfügt, allerdings überwiegt die
rezeptive Seite bei der Verarbeitung sprachlicher Stimuli (vgl. BRADSHAW/NETTLETON
1981). Die rechtshemisphärische Sprachproduktion besteht hauptsächlich
aus Klischees und konventionellen Redewendungen (z.B. Guten Tag)
und aus der Verwendung konkreter hochfrequenter (häufig vorkommender)
Wörter (vgl. LEUNINGER 1989). Abstrakte, hochfrequente Wörter
hingegen werden in erster Linie von der linken Hemisphäre verarbeitet. Wissenschaftler nehmen an, daß sprachliche Stimuli, welche nicht
analytisch verarbeitet werden müssen, jedoch als holistische oder
Gestalteinheiten abgerufen werden können (LEUNINGER 1989:6), auch
von der rechten Hemisphäre erzeugt werden. Für den Bereich der
syntaktischen und phonologischen Kompetenzen muß aber eindeutig die
Dominanz der linken Hemisphäre bestimmt werden (vgl. ENDER 1994).
Hinzu kommt, daß die linke Hemisphäre ihren Wortschatz taxonomisch
organisiert, also in Kategorien von Ober- und Unterbegriffen, während
die rechte Gehirnhälfte ihren Wortschatz in Termen von assoziativ
angereicherten, gestalthaft leicht zugänglichen und vorstellbaren
ganzen Situationen speichert (HEESCHEN/REISCHIES :53).
So ist die rechte Hemisphäre immerhin in der Lage, konkrete Assoziationen
zu bilden (wie z.B. Bleistift - wird zum Schreiben benutzt) und
verfügt auch über die Fähigkeit, bis zu vier Assoziationen
pro dargebotenen Begriff zu vollziehen (wie z.B. Löffel: Suppe
- Koch - Gabel - Besteck). Die Klasse der abstrakten Assoziationen
kann jedoch nur von der linken Hemisphäre bewältigt werden (wie
z.B. Löffel: Ernährung).
Wissenschaftler nehmen an, daß sprachliche Stimuli, welche nicht
analytisch verarbeitet werden müssen, jedoch als holistische oder
Gestalteinheiten abgerufen werden können (LEUNINGER 1989:6), auch
von der rechten Hemisphäre erzeugt werden. Für den Bereich der
syntaktischen und phonologischen Kompetenzen muß aber eindeutig die
Dominanz der linken Hemisphäre bestimmt werden (vgl. ENDER 1994).
Hinzu kommt, daß die linke Hemisphäre ihren Wortschatz taxonomisch
organisiert, also in Kategorien von Ober- und Unterbegriffen, während
die rechte Gehirnhälfte ihren Wortschatz in Termen von assoziativ
angereicherten, gestalthaft leicht zugänglichen und vorstellbaren
ganzen Situationen speichert (HEESCHEN/REISCHIES :53).
So ist die rechte Hemisphäre immerhin in der Lage, konkrete Assoziationen
zu bilden (wie z.B. Bleistift - wird zum Schreiben benutzt) und
verfügt auch über die Fähigkeit, bis zu vier Assoziationen
pro dargebotenen Begriff zu vollziehen (wie z.B. Löffel: Suppe
- Koch - Gabel - Besteck). Die Klasse der abstrakten Assoziationen
kann jedoch nur von der linken Hemisphäre bewältigt werden (wie
z.B. Löffel: Ernährung).
Bemerkenswert ist die Tatsache, daß bei Verletzungen in der rechten
Hemisphäre auch aphasische Symptome auftreten. So können Benennstörungen
und Wortschatzdefizite durch rechtshemisphärische Läsionen ausgelöst
werden. Empirische Untersuchung weisen auch auf Formen von Agrammatismus
hin, die ansonsten nur in Verbindung mit Broca-Aphasien genannt werden.
Nicht selten führen Läsionen in der rechten Hemisphäre zu
Störungen in der Verwendung und dem Verständnis metaphorischer
Aussagen. Sprichwörter (wie z.B. Lügen haben kurze Beine.)
können nur noch in ihrer wortwörtlichen Bedeutung, d.h. auf rein
propositionaler Aussageebene verstanden und erklärt werden. Die linke
Hemisphäre ist nicht in der Lage, in den Sprichwörtern oder Metaphern
die jeweiligen sprachlichen Bilder zu erkennen. So würde die linke
Hemisphäre die Metapher ein schweres Herz, nicht als eine Bezeichnung
für eine traurige Stimmung verstehen, sondern als eine in Gramm und
Kilogramm meßbare Eigenschaft des Herzens interpretieren. Die rechte
Hemisphäre ist ebenfalls in der Lage, die aphasische Sprachproduktion
der linken Seite zu unterstützen.
Linkshemisphärische Aphasiker, deren rechte Hemisphäre durch
eine Injektion von
Natrium-Amytal-Lösung kurzfristig inaktiviert wurde, verloren bemerkenswerterweise jegliches
Sprachvermögen (vgl. ENDER 1994). So kann vermutet werden, daß
die sprachlichen Resterscheinungen wie Automatismen, emotionales Sprachgut
wie Tabuwörter
kurzfristig inaktiviert wurde, verloren bemerkenswerterweise jegliches
Sprachvermögen (vgl. ENDER 1994). So kann vermutet werden, daß
die sprachlichen Resterscheinungen wie Automatismen, emotionales Sprachgut
wie Tabuwörter ,
die bei Globalaphasikern beobachtet werden können, expressive Leistungen
der rechten Hemisphäre sind. Im Gegensatz dazu betonen HEESCHEN/REISCHIES
(:52) in ihrer Arbeit die enge
Verbindung von Emotionalität und rechter Gehirnhälfte und kommen
zu der Folgerung, rechtshemisphärisch keine spezielle sprachliche
Fähigkeit anzunehmen. Die rechte Gehirnhälfte zeige
,
die bei Globalaphasikern beobachtet werden können, expressive Leistungen
der rechten Hemisphäre sind. Im Gegensatz dazu betonen HEESCHEN/REISCHIES
(:52) in ihrer Arbeit die enge
Verbindung von Emotionalität und rechter Gehirnhälfte und kommen
zu der Folgerung, rechtshemisphärisch keine spezielle sprachliche
Fähigkeit anzunehmen. Die rechte Gehirnhälfte zeige
keine Dominanz für einen speziellen Subaspekt von Sprache, sondern wäre lediglich Ausdruck und Folge ihrer engeren Verbindung mit Emotionalität.Generell verfolgen beide Autoren in ihrer Arbeit das Ziel, die rechte Hemisphäre bezüglich ihrer sprachlichen Fähigkeit abzuwerten, und die linke Hemisphäre wieder zur exklusiv dominanten Hemisphäre für Sprache beim Erwachsenden zu machen. Der Split-Brain Forscher Michael S. Gazzaniga kommt zu dem Schluß,
(HEESCHEN/REISCHIES :52)
daß unsere ersten Fälle Ausnahmen waren, denn bei den meisten Menschen kann die rechte Hemisphäre nicht einmal einfachste sprachliche Aufgaben bewältigen. Das besagen auch neurologische Befunde von Schlaganfallpatienten: Die Folgen eines linksseitigen Hirninfarkts sind für das Sprachvermögen wesentlich fataler.Trotzdem muß davon ausgegangen werden, daß die rechte Hemisphäre einen ganz spezifischen Beitrag zur verbalen Kommunikationsfähigkeit leistet. Nur sie allein ist in der Lage, emotionale Intonation
(GAZZANIGA 1998:87)
 und metaphorische Wendungen zu interpretieren. Ihre konnotative, assoziative
und bildhafte Interpretation von Sprache darf nicht ignoriert werden.
und metaphorische Wendungen zu interpretieren. Ihre konnotative, assoziative
und bildhafte Interpretation von Sprache darf nicht ignoriert werden.
Diese spezifische und ausschließlich der rechten Hemisphäre zukommende Kompetenz mag zwar, je nach Sprachauffassung, als eine nichtsprachliche gedeutet werden, sie ist aber dennoch als essentieller Teil pragmatischer Möglichkeitsbedingungen verbaler Kommunikation von außerordentlicher Bedeutung. Sie erst stellt die einzelne Äußerung in ihren kontextuellen Bezugsrahmen, sichert die Diskursfunktionen der Sprache und die Abläufe und Inhalte normaler, also gelungener Kommunikation.Seit der Einführung der Computertomographie werden in zunehmendem Maße auch aphasische Störungsbilder bei Patienten mit subkortikalen Läsionen, insbesondere im Thalamus, beobachtet.
(ENDER 1994:228)
 Vor diesem Hintergrund liefert die abschließende Betrachtung einen
Einblick über die spezifischen sprachverarbeitenden Funktionen des
Thalamus.
Vor diesem Hintergrund liefert die abschließende Betrachtung einen
Einblick über die spezifischen sprachverarbeitenden Funktionen des
Thalamus.
 Ebenso ist die Sprachflüssigkeit beeinträchtigt. Die Sprache
ist oft verlangsamt und monoton. Dieses Störungsbild wird als thalamische
Aphasie bezeichnet, denn unter Forschern besteht Einigkeit darüber,
Ebenso ist die Sprachflüssigkeit beeinträchtigt. Die Sprache
ist oft verlangsamt und monoton. Dieses Störungsbild wird als thalamische
Aphasie bezeichnet, denn unter Forschern besteht Einigkeit darüber,
daß Läsionen thalamischer Kerne der sprachdominanten Hemisphäre - vor allem bei Thalamusblutungen - umschriebene und zum Teil schwergradige und anhaltende sprachliche Ausfälle verursachen können. Das Störungsbild ist durch eine reduzierte spontane Sprachproduktion und semantisch-lexikalische Defizite bei relativ erhaltenen Sprachverständnis- und Nachsprechleistungen charakterisiert.Versuche mit elektrischen Reizungen des Thalamus haben ergeben, daß ihm beim Sprechen zwei grundlegende Funktionen zukommen. Nach dem Neurochirurgen George Ojemann steuert der Thalamus einerseits die Aufmerksamkeit auf sprachliche Stimuli in seiner Umwelt und sorgt für einen korrekten verbalen Abruf aus dem sprachlichen Gedächtnisspeicher, und andererseits kontrolliert er die Atmung und Sprechmuskulatur während des Sprechvorgangs (vgl. CALVIN/OJEMANN 1995).
(ZIEGLER 1997:134)
